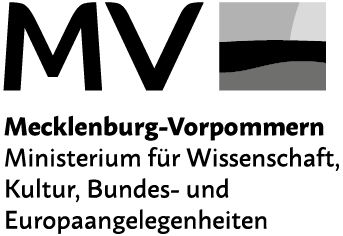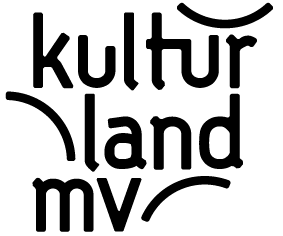Ausstellungstext
Mit we᾽re doing alien᾽s milk aren᾽t we? präsentiert der Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin die erste institutionelle Einzelausstellung der britischen Künstlerin Emily Jones in Deutschland. Die Ausstellung vereint neue, eigens für die Räume des Kunstvereins geschaffene Arbeiten, die sich weniger als abgeschlossene Objekte, sondern vielmehr als vieldeutige Erfahrungsräume entfalten. In ihrer Deutungsoffenheit setzen sich die Installationen kritisch mit gegenwärtigen Formen des Zusammenlebens auseinander und stellen Fragen nach individueller und kollektiver Verantwortung. Dabei verweben sie neue relationale Zusammenhänge zwischen Disziplinen, die oft getrennt voneinander gedacht werden – wie Wissenschaft, Ökologie, Geschichte, Architektur, Technologie, Archäologie, Geografie, Kosmologie, Erinnerung und Glaube.
Im Zentrum von we᾽re doing alien᾽s milk aren᾽t we? steht eine künstlerisch experimentelle Auseinandersetzung mit den epistemischen und materiellen Ordnungen, die der Mensch über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat, um sich selbst und die Natur zu vermessen, zu organisieren und zu beherrschen. Zeitordnungssysteme (Kalender, Zeiteinteilungen, Rhythmen, Epochen, Zeitmessungen), Raumordnungssysteme (Koordinatensysteme, Kartografien, Grenzziehungen), Normierungs- und Standardisierungssysteme (Maßeinheiten wie Meter, Gramm, Liter), rechtlich-politische Ordnungssysteme (Gesetze, Verfassungen, Verwaltungssysteme) sowie Zeichen- und Symbolsysteme (Schrift-, Zahlen- und Notationssysteme, Symbole, Rituale) sind Ausdruck einer von westlichen Herrschaftsansprüchen und einem linearen Fortschrittsglauben geprägten Rationalität, die auf Berechenbarkeit und Kontrolle abzielt. Diese historisch gewachsenen Strukturen wirken – als Dispositive der Disziplinierung und Machtausübung – nicht nur auf das Wissen und den Umgang mit der Welt, sondern formen zugleich auch die Subjekte, die in ihr Handeln. Disziplin entfaltet sich dabei nicht allein durch Strafe, sondern ebenso durch Belohnung.
Emily Jones reagiert auf diese genealogisch gewachsenen Wirkungszusammenhänge mit einer Ästhetik des Fragmentarischen, des Relationalen, des Provisorischen und des Spekulativen. In multisphärischen Raumgefügen, die physische wie emotionale Dimensionen gleichermaßen adressieren, collagiert sie skulpturale, auditive, textuelle und performative Elemente zu modellhaften Situationen, die diese – externen wie internalisierten – Kontroll- und Ordnungssysteme kontinuierlich infrage stellen. Modelle, Zeitmesssysteme, (vermeintliche) Wertgegenstände und Disziplinartechnologien werden dabei in spekulative Möglichkeitsräume überführt, die alternative Formen von Fürsorge, Teilhabe und kollektiver – ökologischer, ökonomischer und sozialer – Verantwortung eröffnen.
Ihr künstlerisches Formenrepertoire speist sich dabei aus vorgefundenen Objekten, Materialien und visuellen Sprachen, die die Künstlerin aus Kontexten wie der DIY-Kultur, der kollektiven Selbstorganisation oder pädagogischen Praktiken bezieht. Organische Materialien treten in einen Dialog mit digital erzeugten Formen; Alltagsobjekte begegnen (mytho-)poetischen Narrativen, wodurch hybride Bild- und Bedeutungsräume entstehen. Sprache fungiert dabei nicht als Instrument der Kontrolle oder Zuschreibung, sondern als ein Mittel, Bedeutungen zu verschieben, zu vervielfachen oder gezielt zu destabilisieren.
Wie schon im Titel angelegt verweigert sich die Ausstellung we᾽re doing alien᾽s milk aren᾽t we? somit klaren Zuschreibungen und linearen Lesarten und verweist stattdessen vielmehr auf das Potential des Unbekannten, Nichterforschtem und Nicht-Rationalisierbarem. Es entstehen ästhetisch-experimentelle Assoziationsräume, in denen alternative Formen des Miteinanders und der Teilhabe imaginiert und erprobt werden können – jenseits von Beherrschung, Instrumentalisierung und normativen Zuschreibungen. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in performativen Formaten wider, die in Kooperation mit der Künstlerin, dem StarterClub des Mecklenburgischen Staatstheaters und dem Kinderschutzbund Schwerin entstanden sind, und die Ausstellung als Raum des (Ver)Lernens in Perspektive setzen.
Kuratorin
Hendrike Nagel
Material
Biografie
Emily Jones (*1987, London) lebt und arbeitet in London. Ihre Arbeiten wurden bereits in zahlreichen Einzelausstellungen gezeigt, unter anderem bei Centre d‘art contemporain-la synagogue de Delme (2019), Prairie, Chicago (2018), First Continent, Baltimore (2017), VEDA, Florenz (2017), Almanac Inn, Turin/London (2016), Cordova, Wien (2016), S1, Portland (2015) sowie bei Jupiter Woods, London (2014). Zudem waren ihre Arbeiten Teil vieler nationaler und internationaler Gruppenausstellungen, unter anderem im Palais de Tokyo, Paris (2021), Future Gallery, Berlin (2016), Andrea Rosen Gallery, New York (2015), Galerie Andreas Huber, Wien (2015), Import Projects, Berlin (2015) und den Serpentine Galleries, London (2014).
Agenda
Rezensionen
Förderer
In Kollaboration mit:
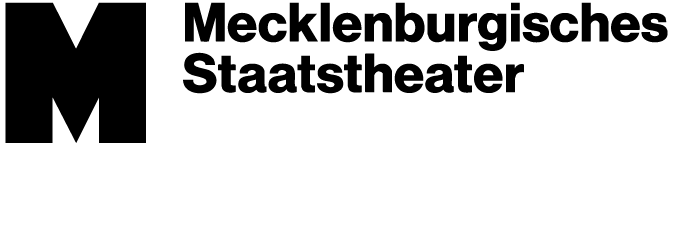

Mit freundlicher Unterstützung: